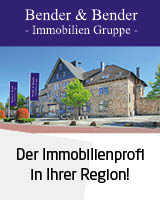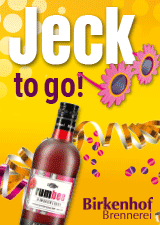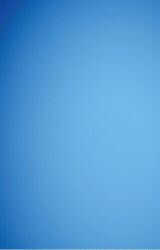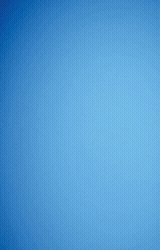Mangel an Therapieplätzen: Zu wenig Therapeuten - doch der Weg dahin ist steinig
 Von Regina Morkramer
Von Regina Morkramer
In Deutschland warten viele Menschen monatelang auf einen Therapieplatz, und der Bedarf wächst stetig. Gleichzeitig ist der Weg in den Beruf der Psychotherapeuten lang, komplex und teuer. Für viele bedeutet das: eine doppelte Hürde.

Region. 31 Prozent der Deutschen leiden unter einer psychischen Erkrankung, so der Mental Health Report 2024. Psychische Erkrankungen gehören in Deutschland mittlerweile zu den häufigsten Ursachen für längere Ausfallzeiten im Beruf. Mit 42 Prozent sind psychische Erkrankungen zudem fast die Hälfte der Begründungen für eine Frührente. Dabei haben seit 2001 vor allem Depressionen (plus 96 Prozent), Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (plus 74 Prozent) sowie Suchterkrankungen (plus 49 Prozent) zugenommen, wie die Bundespsychotherapeutenkammer bekannt gab. Die Notwendigkeit psychotherapeutischer Hilfestellung ist also offenbar vorhanden; nach Angaben der Bundespsychotherapeutenkammer hat sich der Bedarf an Psychotherapie in den letzten 20 Jahren nahezu verdoppelt. Nur am Angebot scheitert es vielerorts.
Die Bundespsychotherapeutenkammer schätzt, dass es in Deutschland tausende sogenannte Kassensitze für Psychotherapeuten zu wenig gibt. Diese Sitze sind jedoch notwendig, damit Therapeuten neben privaten Patienten auch gesetzlich Versicherte behandeln und mit den Krankenkassen abrechnen können. Denn eine Psychotherapie kann teuer werden, rund 100 Euro kostet in der Regel allein eine Sitzung. In Deutschland entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen anhand einer Bedarfsplanung von 1999 darüber, wie viele Psychotherapeuten sich an welchen Orten niederlassen dürfen und welche Leistungen von den Krankenkassen erstattet werden. Experten halten dieses System jedoch für längst überholt. Bundes- und Landespsychotherapeutenkammern fordern eine Reform der Bedarfsplanung.
In der Folge warten Betroffene Studien zufolge rund fünf Monate auf einen Therapieplatz - obwohl gerade im psychischen Bereich oft schnelle Hilfe nötig ist. Viele Psychotherapeuten führen Wartelisten, andere wiederum haben diese bereits abgeschafft, weil sie die Nachfrage ohnehin nicht bewältigen können. Insbesondere auf dem Land kommt es nicht selten zu Versorgungsengpässen. Dabei mangelt es gar nicht unbedingt an Psychotherapeuten. Als im Jahr 2024 in Rheinland-Pfalz auf Initiative der Kassenärztlichen Vereinigung (KV RLP) zwölf neue Kassensitze ausgeschrieben wurden, haben sich 123 Psychotherapeuten darauf beworben. Laut KV RLP fehlen in Rheinland-Pfalz weiterhin rund 200 psychotherapeutische Sitze. "Der Bedarf von Seiten der Patientinnen und Patienten ist enorm. Und wenn wir nun die überaus hohe Anzahl an Bewerbungen sehen, ist für die Bürgerinnen und Bürger in keiner Weise nachvollziehbar, warum hier nicht mehr Kolleginnen und Kollegen beginnen dürfen zu praktizieren", erklärte KV-RLP-Vorstandsmitglied und Psychotherapeut Peter Andreas Staub im vergangenen Jahr.
Berufswunsch Psychotherapeutin: "Finanziell ein echter Kraftakt"
Dabei fangen die Schwierigkeiten schon viel früher an. Esther Piontek ist 31 Jahre alt, sie beginnt im April 2026 ein Psychologiestudium mit dem Ziel, Therapeutin zu werden. Ihr Weg zeigt exemplarisch, wie finanzielle und strukturelle Barrieren diesen Berufsweg erschweren. "Ich kenne das Thema aus beiden Perspektiven", erzählt Esther Piontek. "Ich habe selbst schon nach einem Therapieplatz suchen müssen, was ungefähr ein dreiviertel Jahr lang gedauert hat. Und seit ich den Berufswunsch Psychotherapeutin gefasst und mich mit der Ausbildung auseinandergesetzt habe, merke ich, welche Hürden einem auch dabei begegnen." Die 31-Jährige hat nach dem Abitur zunächst Betriebswirtschaftslehre studiert und viele Jahre im Online-Marketing gearbeitet, zuletzt in leitender Position. Dabei spürte sie, dass ihre eigentliche Stärke in der Arbeit mit Menschen liegt. Letztendlich entschied sie sich für ein Psychologiestudium an einer privaten Universität. "Der Weg ist nicht nur lang, sondern auch finanziell ein echter Kraftakt: Für Bachelor und Master fallen insgesamt rund 46.000 Euro Studiengebühren an."
Und damit ist es noch nicht getan, denn nach Studium und Approbation folgt noch die erforderliche Weiterbildung zur Psychotherapeutin, die wiederum mehrere Jahre dauert und beispielsweise in einer psychiatrischen Klinik stattfindet. "Und genau hier fehlen konkrete Entscheidungen aus der Politik", kritisiert Esther Piontek. "Im Jahr 2020 wurde das Psychotherapeutengesetz angepasst, nach dem es möglich sein soll, während dieser jahrelangen Weiterbildung auch schon Geld zu verdienen - ähnlich wie etwa bei Assistenzärzten. Doch bisher ist nicht geklärt, wie das finanziert werden soll. Das Gesetz wurde in der Praxis bisher nicht umgesetzt, es gibt auch keine verlässliche Übergangsregelung. Deswegen stellen Kliniken beispielsweise keine Weiterbildungsplätze zur Verfügung, weil die Finanzierung nicht geklärt ist."
Mehr Aufmerksamkeit der Politik
Um die Studiengebühren und auch ihren Lebensunterhalt während der langen Zeit bis zur ausgebildeten Psychotherapeutin finanzieren zu können, hat sich Esther Piontek mit verschiedenen Optionen auseinandergesetzt. Stipendien richten sich in erster Linie an Erststudierende, Kredite müssen oft direkt nach dem Studium zurückgezahlt werden - genau dann, wenn sich nach aktuellem Stand eine unbezahlte Ausbildung anschließt. Bildungsfonds vergeben derzeit keine neuen Mittel oder orientieren sich - wie in Esther Pionteks Fall - nach vielen Jahren Berufserfahrung immer noch an den Abiturnoten.
"Wir brauchen dringend mehr Therapieplätze in Deutschland, aber der Weg dahin wird einem auf beiden Seiten so schwer gemacht", fasst Esther Piontek ihre Lage zusammen. "Dabei darf es kein Privileg sein, sich um seine psychische Gesundheit kümmern zu können." Die 31-Jährige wünscht sich mehr Aufmerksamkeit seitens der Politik für das Thema. "Es muss jetzt was passieren - und das in der Theorie gut gedachte und angepasste Psychotherapeutengesetz auch umgesetzt werden." Esther Piontek empfindet es als positiv, dass das Thema psychische Gesundheit gesellschaftlich immer stärker akzeptiert wird und Stigmatisierungen abnehmen. "Dass ich von den Schwierigkeiten erzähle, mit denen ich auf dem Weg zur ausgebildeten Psychotherapeutin kämpfen muss, ist auch mein Beitrag, das Thema weiter öffentlich zu machen. Irgendwann sind wir idealerweise in einer Gesellschaft angekommen, in der jede Person, die es braucht, unkompliziert psychische Hilfe in Anspruch nehmen kann."
Mehr dazu:
Gesundheitsversorgung
Feedback: Hinweise an die Redaktion